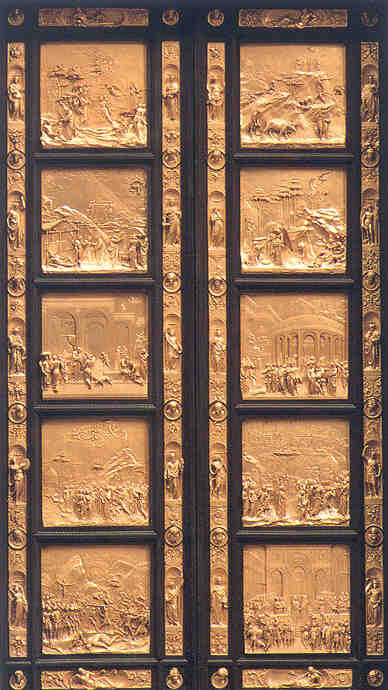4. Tag: Es ist
bewölkt und kühl. Über Ginestra fahren wir auf der Schnellstraße
nach Pisa:
Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert sicherte Pisas Flotte die Vormachtsstellung
der Stadt im westlichen Mittelmeerraum. Handelsbeziehungen mit Spanien und Nordafrika
führten zu wissenschaftlichen und kulturellen Umwälzungen, die sich
in den Bauten der Zeit spiegeln: Kathedrale, Baptisterium und Campanile. Pisas
Stern sank, als der Arno verschlammte. Damals lag die Stadt nur 3 km vom Meer
entfernt. Heute sind es 10 km, denn die Ablagerungen des Arno verlegten die
Küstenlinien immer weiter nach Westen.
Die heutige Provinzhauptstadt mit ungefähr 105.000 Einwohnern erstreckt
sich an den flachen Ufern des Arno. Als freie Seerepublik hatte Pisa zwischen
dem 11. und 13. Jahrhundert einen wirtschaftlichen Höhepunkt. Aus dieser
Zeit stammen der weltberühmte schiefe Turm und die anderen außergewöhnlichen
Baudenkmäler auf der Piazza dei Miracoli (Platz der Wunder), die Pisa zu
einer bedeutenden Kunststadt in der Toskana machten.
Bei einem ersten Blick auf den Stadtplan fällt auf, dass die Piazza dei
Miracoli mit den Dombauten nicht im Zentrum, sondern am nordwestlichen Ende
der Altstadt, in der Nähe der Stadtmauer, liegt. Es ist anzunehmen, dass
wirtschaftliche Interessen ausschlaggebend für die Verlagerung des Stadtbezirkes
in Richtung Arno waren. Auf beiden Seiten des Flusses, der die Stadt heute in
zwei Hälften teilt, stehen schöne alte Paläste. Acht Brücken
und eine Eisenbahnbrücke verbinden die beiden Stadtteile miteinander. Die
mittelalterliche Stadtmauer ist fast vollständig erhalten. Nur im Süden
wurde für die Stadterweiterung um die Piazza Vittorio Emmanuele II und
den Bahnhof ein Teil niedergerissen.
 Rund
um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;
egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt
(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas
heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.
Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)
und alten Cafès.
Rund
um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;
egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt
(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas
heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.
Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)
und alten Cafès.
Über die Ponte Solferino kommen wir über den Arno in die Altstadt
und besuchen als Erstes natürlich die Piazza
dei Miracoli: Der "Platz der Wunder" ist die berühmteste
Sehenswürdigkeit und Touristenmittelpunkt Pisas. Auf der weiten Rasenfläche
gruppieren sich bedeutende Bauwerke um den abgesenkten Dom: das Baptisterium
gegenüber der Westfassade, im Norden der Camposanto Vecchio (alte Friedhof),
im Osten der schiefe Campanile mit dem davorliegenden Dommuseum und auf der
Südseite das Sinopienmuseum. "Sinopien" nennt man die Rötelstift-Vorzeichnungen
bei der Herstellung von Fresken.
 Dom:
Der Dombau, 1063 von dem Archtekten Buscheto erbaut, 1118 unvollendet geweiht,
wurde erst gegen 1200 fertiggestellt. Die Gesamtanlage der gewaltigen fünfschiffigen
Basilika mit ausladendem dreischiffigen Querhaus, Vierungskuppel und großräumiger
Choranlage diente den späteren Kathedralen von Florenz und Siena als Vorbild.
Dom:
Der Dombau, 1063 von dem Archtekten Buscheto erbaut, 1118 unvollendet geweiht,
wurde erst gegen 1200 fertiggestellt. Die Gesamtanlage der gewaltigen fünfschiffigen
Basilika mit ausladendem dreischiffigen Querhaus, Vierungskuppel und großräumiger
Choranlage diente den späteren Kathedralen von Florenz und Siena als Vorbild.
Die gesamte Kirche ist mit farbigem Marmor verkleidet.
Der fünfschiffige Innenraum mit seinen 68 Säulen wird durch die Streifenoptik
der Marmorinkrustationen belebt und erinnert an islamische Dekorationsformen.
Nach der Legende nach soll der schwere bronzene Kronleuchter im Mittelschiff
Galileo Galilei zur Erforschung der Pendelgesetze gedient haben. Seine Studien
zu den Fallgesetzen erprobte er bereits am damals schon schiefen Campanile.
Das größte Kunstwerk im Innern ist die figurenreiche Kanzel (1302
- 1311) des gotischen Bildhauers Giovanni Pisano, links vor dem Hochaltar. Der
Kanzelkörper, mit ausdrucksstarken Reliefs versehen, steht auf mehrere
Marmorsäulen. Davon ruhen zwei auf Löwen, die anderen sind zum Teil
plastisch ausgearbeitet.
 Baptisterium:
Die Taufkirche gegenüber der Westfassade enthält sowohl romanische
als auch gotische Stilelemente. Trotz der langen Bauzeit von 1153 bis 1358 bietet
das Baptisterium einen harmonischen Gesamteindruck. Zentral in der Mitte steht
das Taufbecken. Das schönste Ausstattungsstück ist die Kanzel von
Nicola Pisano (1259 - 1260), die über 40 Jahre vor der Domkanzel seines
Sohnes Giovanni entstand.
Baptisterium:
Die Taufkirche gegenüber der Westfassade enthält sowohl romanische
als auch gotische Stilelemente. Trotz der langen Bauzeit von 1153 bis 1358 bietet
das Baptisterium einen harmonischen Gesamteindruck. Zentral in der Mitte steht
das Taufbecken. Das schönste Ausstattungsstück ist die Kanzel von
Nicola Pisano (1259 - 1260), die über 40 Jahre vor der Domkanzel seines
Sohnes Giovanni entstand.
 Torre
Pendente (der schiefe Turm): Der Bau des Glockenturms wurde 1173
von Bonanno begonnen und wenige Jahre später wieder eingestellt. Bereits
beim 3. Geschoss begann sich der Turm zu neigen. Ursache dafür war der
sandige Untergrund, das Schwemmland, auf dem die ganze Stadt erbaut ist. Giovanni
di Simone nahm erst 90 Jahre (1274) später
die Bauarbeiten wieder auf, indem er versuchte, gegen die Schrägneigung
anzubauen. Er baut auf die 3 schiefen Stockwerke die restlichen 4 Stockwerke
senkrecht auf, so dass ein kleiner "Knick" im Turm entsteht. Leider
löst di Simone eine erneute Neigungsbewegung aus und stoppt den Bau noch
ohne den an sich unverzichtbaren Glockenstuhl.
Torre
Pendente (der schiefe Turm): Der Bau des Glockenturms wurde 1173
von Bonanno begonnen und wenige Jahre später wieder eingestellt. Bereits
beim 3. Geschoss begann sich der Turm zu neigen. Ursache dafür war der
sandige Untergrund, das Schwemmland, auf dem die ganze Stadt erbaut ist. Giovanni
di Simone nahm erst 90 Jahre (1274) später
die Bauarbeiten wieder auf, indem er versuchte, gegen die Schrägneigung
anzubauen. Er baut auf die 3 schiefen Stockwerke die restlichen 4 Stockwerke
senkrecht auf, so dass ein kleiner "Knick" im Turm entsteht. Leider
löst di Simone eine erneute Neigungsbewegung aus und stoppt den Bau noch
ohne den an sich unverzichtbaren Glockenstuhl.
Im Jahr 1298 messen Giovanni Pisano und
"Meister" Orsello eine Abweichung vom Lot von 143 cm, woraufhin auch
diese die Fertigstellung des Turmes zurückstellen. 1360
hat die Neigung bereits 163 cm erreicht. Um den Turm doch noch als Campanile
nutzen zu können, wagt Tommaso Pisano den Bau des Glockenstuhls, den er
korrekt senkrecht auf den wieder schiefen Unterbau setzte.
1590 führt Galileo Galilei seine Fallexperimente
durch.
Im Jahr 1838 entfernt der Architekt Alessandro
Gherardesca die Turmbasis vom umgebenden Erdmaterial und richtet stattdessen
das Marmorbassin ein. Seine Motive dazu sind nicht bekannt. Möglicherweise
wurde dadurch die Neigungsbewegung wieder ausgelöst und erreichte 1918
einen Überhang von 5,1 m.
Nachdem sich die mittlere jährliche Neigungsbewegung seit 1918 auf 1 -
1,2 mm/Jahr etwas verlangsamt hatte, wird 1990
wieder eine Zunahme gemessen. Die Einsturzgefahr ist offensichtlich und der
Turm wird für die Öffentlichkeit geschlossen. 1994
werden 690 Tonnen Bleibarren als Gegengewicht an der Nordseite des Turmes deponiert.
1995 sollen senkrechte, 40 m tiefe Erdanker
die Wirkung der Bleigewichte unterstützen. Die Neigungsbewegung stoppt
tatsächlich. 1998 wird der Turm mit
2 Stahlseilpaaren abgespannt, die den Druck auf die Fundamente in der Neigungsrichtung
entlasten und auf der Nordseite belasten. Die Seile (Hosenträger getauft)
werden im 3. Turmgeschoss an der inneren Mauer befestigt.
120 Sensoren meldeten jede seiner Bewegungen. 17 Kommissionen wurden einberufen,
doch jede Rettungsaktion beschleunigte nur seinen Verfall.
Ab Februar 1999 kommt eine Technik zum Einsatz,
die in den 60er Jahren an der Kathedrale in Mexiko Stadt bereits Erfolg hatte:
Dabei wird dem Turmuntergrund auf der hangabgewandten Seite Erdmaterial entnommen.
Da Projekt verspricht ca. 30 - 50 cm Korrektur das Überhangs. Zunächst
werden testweise wenige Bohrungen bis in ca. 5 m Tiefe unter dem nördlichen
Fundament angebracht. Bis zu 100 kg Erde fallen täglich als Abraum an.
Das Zwischenergebnis im Mai 1999 war mit 16 mm Aufrichtung und 2 t Aushub erfolgversprechend.
September 2000: 24 cm weniger Überhang.
Nach 11 sorgenvollen Jahren ist die Rettungsaktion für den schiefen Turm
von Pisa abgeschlossen. Er ist immer noch schief, aber zumindest droht er vorerst
nicht mehr umzufallen. Am 16. Juni 2001
wurde er in einer feierlichen Zeremonie wieder für Besucher geöffnet.
Piazza dei Cavalieri: Die anmutige
Piazza (Platz der Ritter) liegt im Universitätsviertel und ist der Hauptplatz
Pisas. 1561 gründete Cosimo I. den Ritterorden von Santo Stefano (Ordine
di Cavalieri di Santo Stefano) zur Verteidigung der Küste gegen Piraten
und Türken. Vasari wurde 1562 mit dem Bau des Palazzo die Cavalieri oder
auch Carovana genannt, betraut. Der ehemalige Ordenssitz beeindruckt durch eine
doppelläufige Treppe und eine vollständige Fassadenbemalung in Sgraffittotechnik.
Dies ist eine besonders wetterbeständige Art der Wandmalerei, die vor allem
an Renaissancebauten in Oberitalien vorkommt. Über einen groben Unterputz
wird eine schwarze, graue oder rötliche Putzschicht gelegt und dann mit
einer weiteren Mörtelschicht überzogen. Solange die letzte Putzschicht
feucht ist, wird mit Kratzeisen und Metallschlingen die Zeichnung eingeritzt
(ital. sgraffiare = kratzen).
Auf dem Platz auf der Höhe des Portals steht ein Denkmal mit der Figur
Cosimo I. (1596) in der Tracht der Stephansritter. Seit 1810 beherbergt der
Palazzo di Cavalieri die Scuola Normale Superiore, von Napoleon gegründet.
In dieser Eliteschule sind nur die Begabtesten des Landes zugelassen. Viele
berühmte Gelehrte wie Galileo Galilei haben in Pisa studiert oder gelehrt.
 Santa
Maria della Spina: Dieses kleine Schmuckstück steht am Hochufer
es Lungarno Gambacorti vor der Ponte Solferino. Ursprünglich lag die Kirche
weiter unten am Fluß bei der Ponte Nuovo, die heute nicht mehr existiert.
Als 1871 die Uferpromenaden aus Angst vor Hochwasserkatastrophen erhöht
wurden, versetzte man Santa Maria della Spina an die heutige Stelle. Die ehemalige
romanische Kirche wurde in der gotischen Zeit (1323) zu einem eleganten Kirchenbau
ausgestattet und mit Fialen, Tabernakeln und einem reichen Skulpturenschmuck
versehen. Man erzählt sich, dass die Pisaner von ihren Kreuzzügen
im Heiligen Land eine Dorne (Spina) aus der Dornenkrone Christi mitbrachten
und in dieser Kirche aufbewahrten, daher auch der Name Santa Maria della Spina.
Santa
Maria della Spina: Dieses kleine Schmuckstück steht am Hochufer
es Lungarno Gambacorti vor der Ponte Solferino. Ursprünglich lag die Kirche
weiter unten am Fluß bei der Ponte Nuovo, die heute nicht mehr existiert.
Als 1871 die Uferpromenaden aus Angst vor Hochwasserkatastrophen erhöht
wurden, versetzte man Santa Maria della Spina an die heutige Stelle. Die ehemalige
romanische Kirche wurde in der gotischen Zeit (1323) zu einem eleganten Kirchenbau
ausgestattet und mit Fialen, Tabernakeln und einem reichen Skulpturenschmuck
versehen. Man erzählt sich, dass die Pisaner von ihren Kreuzzügen
im Heiligen Land eine Dorne (Spina) aus der Dornenkrone Christi mitbrachten
und in dieser Kirche aufbewahrten, daher auch der Name Santa Maria della Spina.
Marina
di Pisa: Der Badeort liegt westlich von Pisa. Besonders
schöne Fotomotive sind die auf Stelzen stehenden Fischerhäuschen inmitten
der breiten Arnomündung mit ihren ausgebreiteten Fischernetzen zum Aalfang.
Entlang der Küste fahren wir dann nach Livorno:
Die Provinzhauptstadt mit 177.000 Einwohnern ist die zweitgrößte
Stadt der Toskana. Sie liegt rund 20 km südlich von Pisa an der flachen,
aber felsigen tyrrhenischen Küste. Livorno besitzt eine der bedeutendsten
Hafenanlagen im Mittelmeer mit Fährverbindungen nach Sizilien, Sardinien,
Korsika, auf den toskanischen Archipel und mit Anlegestellen für Kreuzfahrtschiffe
am alten Porto Mediceo. An den alten Hafen schließt sich im Norden ein
großer und moderner Industriehafen, die Darsena Toscana an. Seit der Nachkriegszeit
nahmen vor allem die Erdölraffinerien einen starken Aufschwung. Von Norden
kommend, prägen riesige Anlagen bereits kilometerlang vor der Stadt die
Küstenlandschaft.
Erst durch die Entstehung des Großherzogtums Toskana im Jahr 1537 unter
Cosimo I. di Medici entwickelte sich Livorno zu einer bedeutenden Hafen- und
Handelsstadt. Cosimo I. ließ eine neue Befestigungsanlage, Kanäle
und Plätze anlegen und den Hafen ausbauen. Zusätzlich kam die Stadt
in den Genuß von Steuerbefreiung. Eine neue Zollordnung öffnete den
Hafen für den internationalen Handel, der noch heute als Medici-Hafen bekannt
ist.
Die fünfeckige Altstadt wird vom Fosso Reale, einem wassergefüllten
alten Festungsgraben, umschlossen und ist von einander sich rechtwinkligen schneidenden
Straßen durchzogen. Im zweiten Weltkrieg wurde die wichtige Hafenstadt
bombadiert und viele Denkmäler, wie die Festungen, die Stadtmauer, Bürgerhäuser
und Villen, stark zerstört. Nach dem Krieg wurde Livorno zum großen
Teil neu aufgebaut und ist heute eine Geschäftsstadt mit modernem Aussehen
und einer verkehrsberuhigten City.
Die Via Grande ist die Hauptstraße
Livornos. Sie durchquert in West-Ost-Richtung vom Hafen bis zur Piazza
Repubblica die Altstadt. Die große Festungsanlage (1590)
im Norden ist fast ringsum von einem breiten Wassergraben, dem Fosso
Reale (königlicher Graben), umgeben.
Herzstück der Stadt ist die Piazza Grande
mit dem Dom San Francesco d´ Assisi (1594 - 1606). Die Piazza Grande ist
der Kreuzungspunkt von Via Grande und Via Cairoli.
Heimfahrt bei starkem Regen und Einkaufsstopp beim Dorfgreißler in Malmantile.
Das Wetter heute: Vormittag bewölkt
mit sonnigen Abschnitten, Nachmittag kühl, windig und zunehmend regnerisch.
5. Tag:
Florenz, die Hauptstadt der Toskana, gehört mit Venedig
und Rom zu den bedeutendsten Kunstzentren Italiens.
Es war Julius Cäsar der im Jahr 59 v. Chr. hier, an der Via Cassia, eine
Veteranenkolonie gründete. Von ihr blieb nur die rechtwinklige Straßenanlage
um das ehemalige Forum (Piazza della Repubblica) erhalten. Die Zunahme des Warenverkehrs
auf der Via Cassia um das Jahr 1000 begünstigte den wirtschaftlichen Aufschwung.
Damals entstanden schon erste Bauten wie das Baptisterium und San Miniato al
Monte.
Die fast schon industriell organisierte Verarbeitung von Wolle und Seide sowie
in ganz Europa verzweigte Bankgeschäfte bildeten die Grundlage für
den zunehmenden Reichtum in Florenz. Kaufleute und Handwerker schlossen sich
in Zünften zusammen und übernahmen die Regierung in der freien Kommune,
die Ende des 13. Jahrhunderts mit 100.000 Einwohnern zu den europäischen
Großstädten zählte. Jetzt erst wurden auch in Florenz die ersten
Monumentalbauten errichtet und die Grundsteine für den Bargello, den Palazzo
Vecchio und die großen Ordenskirchen gelegt. Die einflussreichen Familien
(Strozzi und Pitti) wetteiferten mit den Medici beim Bau ihrer Stadtpaläste
wie auch um die Macht in der Republik. Diese oft blutigen Auseinandersetzungen
endeten 1434, als Cosimo di Medici nach seiner Rückkehr aus dem Exil in
Venedig die faktische Alleinherrschaft übernahm.
Aus dem Stadtstaat entwickelte sich ein Regionalstaat, den Kaiser Karl V. im
Jahr 1530 den Medici als erbliches Herzogtum überließ. Florenz verlor
seine autonome Stellung und wurde in das neue Herzogtum eingebunden. Nur zwischen
1865 und 1871 trumpfte es als Hauptstadt Italiens und Sitz des Königshofes
noch einmal mächtig auf.
Heute kämpfen die Einwohner von Florenz (387.500) vor allem mit Umweltproblemen,
die ihre Kunstschätze (viele Skulpturen auf Plätzen und an Fassaden
wurden durch Kopien ersetzt) und ihre Gesundheit bedrohen. Das Stadtzentrum
ist für den Individualverkehr gesperrt.
Wir parken unser Auto in der Nähe der "Ponte di Vittoria" auf
einem bewachten Parkplatz und marschieren zu Fuß 40 Minuten in die Altstadt.
Es regnet nicht mehr und so beginnen wir den Stadtrundgang bei der Piazza
della Repubblica:
Bevor dieser Platz 1890 angelegt wurde, stand hier der Mercato Vecchio (Alter
Markt), und noch früher hatte sich hier das römische Forum befunden.
Eine einzige Säule des Alten Marktes ist erhalten geblieben und wird von
einer Statue, der Abbondanza (des Überflusses) gekrönt. Die Westseite
des Platzes der Republik beherrscht ein Triumphbogen, den man 1895 errichtete,
um die Erhebung von Florenz zur Hauptstadt Italiens zu feiern.
Der Platz wird heute von Straßencafés gesäumt.

 Piazza
del Duomo: Der Dom "San Maria del Fiore" in Florenz
ist die viertgrößte Kathedrale der Welt und wird nur noch durch den
Petersdom in Rom, St. Paul´s in London und den Mailänder Dom an Größe
übertroffen. An der Stelle der kleinen Vorgängerkirche "San Reparata"
wurde bereits 1296 unter der Leitung von Arnolfo di Cambio mit dem gotischen
Bau begonnen. In der neuen Kathedrale sollten 30.000 Personen, die gesamte florentinische
Bevölkerung, Platz finden. Über 100 Jahre arbeiteten unzählige
Arbeiter an dieser Großbaustelle. Erst 1420 wurde Filippo Brunelleschi
(1377 - 1446) mit dem imposanten Kuppelbau beauftragt. Mit einem freien Innendurchmesser
von 41,5 m gab es zuvor außer dem Pantheon keine vergleichbare Kuppel
dieser Größenordnung. Brunelleschi erfand eine völlig neue Konstruktionsmethode.
Unter Verwendung von im Fischgrätenmuster angelegten Ziegelsteinen ließ
er ein ringförmiges Mauerwerk anlegen. Die nächsten Mauerringe wurden
mit eingebauten senkrechten Haken aufgehängt. Durch diese neuartige Konstruktion
vermied er sowohl gefährliche Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk
als auch die problematische Herstellung eines traditionellen, gewölbten
Holzgerüsts. Um die Innenkuppel vor der Witterung zu schützen, ließ
Brunelleschi zusätzlich noch eine äußere Kuppel errichten. Beide
Schalen wurden durch starke Gewölberippen miteinander verbunden. Über
463 Stufen führen durch die doppelschalige Kuppel zur Laterne hinauf. Von
hier genießt man einen der schönsten Rundblicke von Florenz.
Piazza
del Duomo: Der Dom "San Maria del Fiore" in Florenz
ist die viertgrößte Kathedrale der Welt und wird nur noch durch den
Petersdom in Rom, St. Paul´s in London und den Mailänder Dom an Größe
übertroffen. An der Stelle der kleinen Vorgängerkirche "San Reparata"
wurde bereits 1296 unter der Leitung von Arnolfo di Cambio mit dem gotischen
Bau begonnen. In der neuen Kathedrale sollten 30.000 Personen, die gesamte florentinische
Bevölkerung, Platz finden. Über 100 Jahre arbeiteten unzählige
Arbeiter an dieser Großbaustelle. Erst 1420 wurde Filippo Brunelleschi
(1377 - 1446) mit dem imposanten Kuppelbau beauftragt. Mit einem freien Innendurchmesser
von 41,5 m gab es zuvor außer dem Pantheon keine vergleichbare Kuppel
dieser Größenordnung. Brunelleschi erfand eine völlig neue Konstruktionsmethode.
Unter Verwendung von im Fischgrätenmuster angelegten Ziegelsteinen ließ
er ein ringförmiges Mauerwerk anlegen. Die nächsten Mauerringe wurden
mit eingebauten senkrechten Haken aufgehängt. Durch diese neuartige Konstruktion
vermied er sowohl gefährliche Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk
als auch die problematische Herstellung eines traditionellen, gewölbten
Holzgerüsts. Um die Innenkuppel vor der Witterung zu schützen, ließ
Brunelleschi zusätzlich noch eine äußere Kuppel errichten. Beide
Schalen wurden durch starke Gewölberippen miteinander verbunden. Über
463 Stufen führen durch die doppelschalige Kuppel zur Laterne hinauf. Von
hier genießt man einen der schönsten Rundblicke von Florenz.
Doch nicht nur im Hochsommer warten hier Besucherschlangen, um auf die Kuppel
hochsteigen zu können.
Battistero San Giovanni: Das Baptisterium
ist eines der ältesten mittelalterlichen Bauwerke der Stadt (1059 - 1150).
Die große achteckige Taufkirche diente als Vorbild für die Renaissancearchitektur.
Bis zum 19. Jahrhundert wurden alle Florentiner Bürger hier getauft. Während
das zweischalige Wandsystem mit in Nischen eingestellten antiken Säulen
eher an das römische Pantheon erinnert, sind der achteckige Grundriß
und architektonische Details mit byzantinischen und karolingischen Bauten vergleichbar.
Die Marmorverkleidung besteht nicht aus massiven Blöcken, sondern aus 4
- 5 cm dünne Platten, die den Mauern aus Bruchgestein vorgelegt sind. Nur
zwei Farben werden hier verwendet, der weiße Carrara-Marmor und der grüne
Marmor aus Prato.
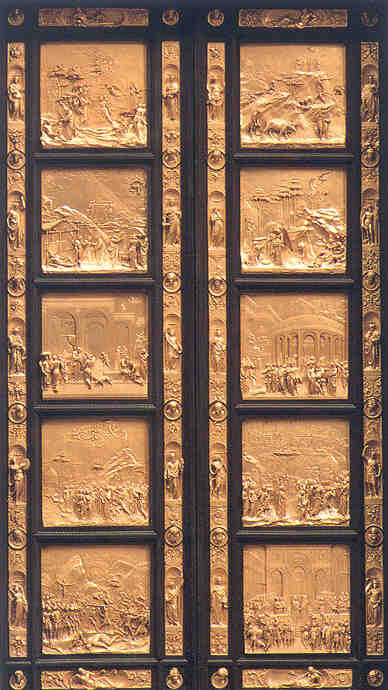
 Berühmt
ist das Baptisterium für seine drei reliefgeschmückten Bronzetüren:
Berühmt
ist das Baptisterium für seine drei reliefgeschmückten Bronzetüren:
1. Die südliche Bronzetür von Andrea Pisano (1330 - 1336). In 28 Feldern
schildern die Reliefs das Leben des Kirchenpatrons Johannes des Täufers
und die personifizierten Tugenden.
2. Die nördliche Bronzetür von Lorenzo Ghiberti (1403 - 1424). Auf
ihr sieht man 28 Szenen aus dem Leben Jesu, der vier Kirchenväter und der
vier Evangelisten.
3. Die östliche, dem Dom zugewandte Bronzetür von Lorenzo Ghiberti
(1425 - 1452). Die sogenannte Paradiespforte zeigt Szenen aus dem alten Testament
auf 10 Bildfeldern.
Palazzo Strozzi: ist der größte
Palast von Florenz. 1434 wurde die Familie Strozzi wegen Differenzen mit den
Medici aus Florenz verbannt, doch 1466 kehrte der Bankherr Filippo Strozzi,
der in Neapel ein Vermögen gemacht hatte, in die Stadt zurück, um
seinen Rivalen zu übertrumpfen. Besessen von seiner Idee, kaufte er alle
Gebäude rund um seinen Palazzo auf und ließ sie abreißen. Schließlich
hatte er genügend Grund erworben, um seinen Plan in die Tat umzusetzen
und den größten Palast errichten zu lassen, den Florenz je gesehen
hatte. Ab 1489 begannen die Mauern zu wachsen. Zwar bekam der Palast nur 3 Stockwerke,
doch ist jede Etage für sich größer als ein normaler Palast.
Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung verstarb Filippo. Seine Erben, die den
Bau fertig stellen ließen, kostete dieser Größenwahn den letzten
Pfennig, so dass die Familie zuletzt bankrott war.
Piazza della Signoria: Seit Jahrhunderten
ist die Piazza della Signoria das weltliche Zentrum der Stadt. An der Südseite
des Platzes steht die Loggia di Lanzi (1382), die früher della Signoria
oder dei Signori hieß. Die Loggia di Lanzi von Orcagna, ist nach den Landsknechten
der Schweizer Garde benannt, die Cosimo I. als Leibwächter dienten. An
der Rückwand der Arkadenhalle stehen altrömische Statuen von Priesterinnen.
 Fontana
del Nettuno: Der Neptun-Brunnen, von Ammannati (1563 - 1575)
entworfen, steht an der Nordwestecke des Stadtpalastes und beeindruckt vor allem
auf Grund seiner Größe.
Fontana
del Nettuno: Der Neptun-Brunnen, von Ammannati (1563 - 1575)
entworfen, steht an der Nordwestecke des Stadtpalastes und beeindruckt vor allem
auf Grund seiner Größe.
Vor dem Eingang zum Palazzo Vecchio stehen sich zwei Statuen auf hohen Sockeln
und von jeder Stelle des Platzes gut sichtbar gegenüber. Links eine Kopie
des berühmten "David" von Michelangelo (das Original befindet
sich in der Galleria dell´ Accademia) und rechts die Marmorgruppe Bandinellis
"Herkules tötet Cacus" von 1534. Das Symbol für die Kraft
des Volkes steht dem Zeichen der Macht der Medici gegenüber.
 Der
Palazzo Vecchio (Alter Palast) erfüllt
noch immer seine ursprüngliche Funktion als Rathaus. Nach seiner Fertigstellung
wurde 1322 eine riesige Glocke zu dem eindrucksvollen Glockenturm hinaufgezogen,
die die Bürger zu Versammlungen rief oder vor Feuer, Hochwasser und Angriffen
warnte. Der Palazzo hat sein aussehen bewahrt, doch ließ Herzog Cosimo
I., als er 1540 den Palazzo als Residenz wählte, das Innere umbauen. Leonardo
und Michelangelo sollten die Räumlichkeiten ausschmücken, doch war
es Vasari, der schließlich diese Arbeit ausführte. Seine Fresken
(1563 - 1565) preisen Cosimo und das von ihm geschaffene Großherzogtum
Toskana.
Der
Palazzo Vecchio (Alter Palast) erfüllt
noch immer seine ursprüngliche Funktion als Rathaus. Nach seiner Fertigstellung
wurde 1322 eine riesige Glocke zu dem eindrucksvollen Glockenturm hinaufgezogen,
die die Bürger zu Versammlungen rief oder vor Feuer, Hochwasser und Angriffen
warnte. Der Palazzo hat sein aussehen bewahrt, doch ließ Herzog Cosimo
I., als er 1540 den Palazzo als Residenz wählte, das Innere umbauen. Leonardo
und Michelangelo sollten die Räumlichkeiten ausschmücken, doch war
es Vasari, der schließlich diese Arbeit ausführte. Seine Fresken
(1563 - 1565) preisen Cosimo und das von ihm geschaffene Großherzogtum
Toskana.
 Uffizien:
Zwischen Arno-Ufer und Palazzo Vecchio erstreckt sich das U-förmige Gebäude
der Uffizien (Ämter). Als Verwaltungssitz seiner neuen toskanischen Regierung
ließ Cosimo I. 1560 - 1580 einen Gebäudekomplex mit Büros (uffizi)
errichten. Die oberste Etage plante der Architekt Vasari als verglaste Loggien,
die Cosimos Nachfolge ab 1581 als Ausstellungsräume für die Kunstschätze
der Familie Medici nutzten. So entstand die wohl älteste Gemäldegalerie
der Welt. Die Uffizien geben in 45 Sälen einen Überblick über
die toskanische Kunst, besitzen aber auch großartige Werke anderer italienischer,
sowie deutscher und niederländischer Meister.
Uffizien:
Zwischen Arno-Ufer und Palazzo Vecchio erstreckt sich das U-förmige Gebäude
der Uffizien (Ämter). Als Verwaltungssitz seiner neuen toskanischen Regierung
ließ Cosimo I. 1560 - 1580 einen Gebäudekomplex mit Büros (uffizi)
errichten. Die oberste Etage plante der Architekt Vasari als verglaste Loggien,
die Cosimos Nachfolge ab 1581 als Ausstellungsräume für die Kunstschätze
der Familie Medici nutzten. So entstand die wohl älteste Gemäldegalerie
der Welt. Die Uffizien geben in 45 Sälen einen Überblick über
die toskanische Kunst, besitzen aber auch großartige Werke anderer italienischer,
sowie deutscher und niederländischer Meister.
 Ponte
Vecchio (Alte Brücke): Die Südseite der Uffizien öffnet
sich mit einer Loggia zum Arno. Gleich rechts überspannt mit 3 Bögen
die älteste Brücke Florenz den Fluß. Sie stammt aus dem Jahr
1345, während der Vasari-Gang, über der linken Seite verlaufend, erst
im 16. Jahrhundert angebaut wurde. Die Häuser auf der Brücke wurden
schon immer gewerblich genutzt. Zunächst richteten Metzger ihre Läden
auf der Brücke ein, die ihre Abfälle in den Fluss warfen. Großherzog
Cosimo I., der täglich auf dem Weg zu seinen Amtsgeschäften die Brücke
überqueren musste, störte der Gestank. Er verordnete, dass nur noch
die Zunft der Goldschmiede auf der Brücke ihrem Gewerbe nachgehen durften.
Seither sind hier traditionell Juwelier- und Goldschmiede-Geschäfte untergebracht.
Ponte
Vecchio (Alte Brücke): Die Südseite der Uffizien öffnet
sich mit einer Loggia zum Arno. Gleich rechts überspannt mit 3 Bögen
die älteste Brücke Florenz den Fluß. Sie stammt aus dem Jahr
1345, während der Vasari-Gang, über der linken Seite verlaufend, erst
im 16. Jahrhundert angebaut wurde. Die Häuser auf der Brücke wurden
schon immer gewerblich genutzt. Zunächst richteten Metzger ihre Läden
auf der Brücke ein, die ihre Abfälle in den Fluss warfen. Großherzog
Cosimo I., der täglich auf dem Weg zu seinen Amtsgeschäften die Brücke
überqueren musste, störte der Gestank. Er verordnete, dass nur noch
die Zunft der Goldschmiede auf der Brücke ihrem Gewerbe nachgehen durften.
Seither sind hier traditionell Juwelier- und Goldschmiede-Geschäfte untergebracht.
Palazzo Pitti: Der mächtige
Repräsentationsbau wurde 1458 von der Pitti-Familie in Auftrag gegeben.
Er sollte den Palast der Medici in den Schatten stellen. Doch die Pittis mussten
ihr zu groß gewordenes Stadtpalais aus finanziellen Gründen 1549
an Eleonora von Toledo, die Gemahlin Cosimos I., verkaufen. Ab 1560 residierten
hier die toskanischen Großherzöge, bis 1580 wurde der Palazzo Pitti
ständig erweitert. Er erstreckt sich über eine Länge von 205
m.
Vasaris Korridor: Der Corridoio
Vasariano ist nach dem Hofarchitekten der Medici-Herzöge, Giorgio Vasari,
benannt und verbindet den Palazzo Vecchio mit dem Palazzo Pitti. Dieser Geheimgang
ermöglichte es den Mitgliedern der Familie Medici, zwischen ihren Residenzen
hin und her zu gehen, ohne sich unter das gewöhnliche Volk mischen zu müssen.
Gleichzeitig konnten sie die Gemälde bewundern, die die Wände des
Korridors zum Teil noch heute schmücken.
Auf der Borgo San Frediano kommen wir durch das alte Stadttor auf die Via Pisana
und wieder zu unserem Auto.
Das Wetter heute: In der Nacht Gewitter,
in der Früh starker Regen und sehr kalt. Untertags abwechselnd etwas Sonne,
Wolken und ein paar Regentropfen bei ca. 20°C.
« zurück weiter
»
 Rund
um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;
egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt
(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas
heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.
Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)
und alten Cafès.
Rund
um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;
egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt
(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas
heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.
Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)
und alten Cafès.